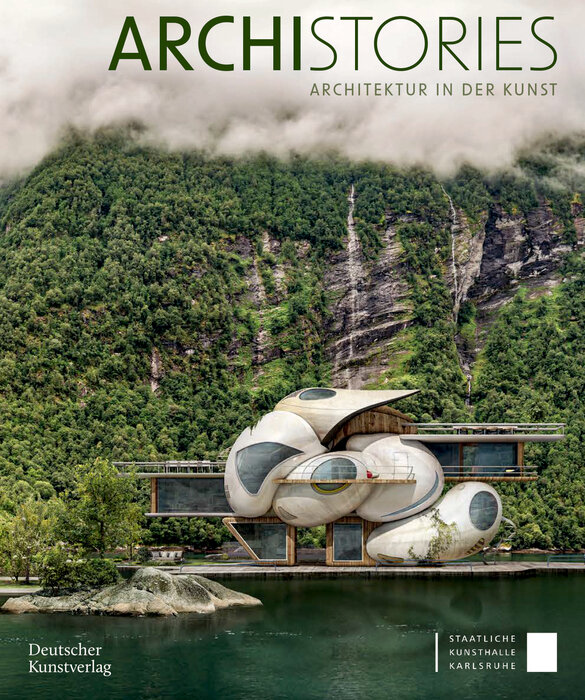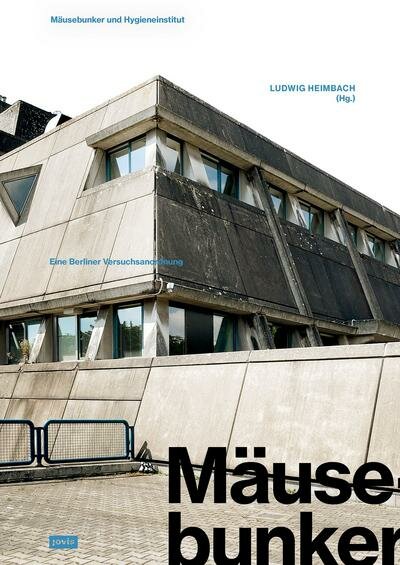… Der in leuchtendem Zinnoberrot und großen Namenslettern seines Protagonisten gestaltete Einband (Gestaltung und Satz von Demian Bern) verspricht einen frischen Blick auf das Werk eines etwas sperrigen, in Vergessenheit geratenen Architekten, der immerhin in den 1920er-Jahren zu den einflussreichsten Vertretern des Neuen Bauens und im Besonderen, des organhaften Bauens, gehörte.
Die Publikation ist auf den ersten Blick klassisch aufgebaut: einleitende Texte zur Person und ihrem Wirken sowie ein Werkkatalog mit ausgewählten Planungen und Bauten. Dabei handelt es sich nicht, um dies vorweg zu nehmen, um eine gekürzte Neuauflage der Schirren-Monografie von 2001. Das Neue in der vorliegenden Publikation will hingegen durch den Leser entdeckt werden. Interessant für die Häring-Forschung erscheinen unter diesem Aspekt daher die beiden Texte der Kunsthistorikerinnen Sylvia Claus und Judith Bihr. Der Spannungsbogen der beiden Beiträge reicht von der internationalen Rezeption bis zur lokalen Einflusssphäre Härings. Die daraus resultierenden neuen Erkenntnisse tragen wesentlich zur besseren Verortung von Werk und Person in der bisher eher unterbeleuchteten Spätphase des Architekten in der Nachkriegszeit bei.
Exkurs: Häring hatte zweifelsohne seine berufliche Hochphase in Berlin in den Goldenen Jahren der Weimarer Republik. Im Gegensatz zu manchen seiner Kollegen der damaligen Avantgarde sympathisierte er nicht, aufgrund seines humanistischen Weltbilds, mit dem Nazi-Regime, was ihm im Umkehrschluss den Karriereknick und das Ende seiner Berufsausübung bescherte. Zurückgezogen, in der sogenannten „inneren Emigration“, widmete er sich der Theorie, bis er 1943 als „Rucksack-Berliner“ in seine Geburtsstadt heimkehrte. Nach Kriegsende konnte Häring nicht mehr an seine durchaus internationale Reputation, als ehemaliger Sekretär der Vereinigung des „Rings“ beziehungsweise der deutschen Delegation des CIAMs, anknüpfen. Andere Netzwerke organisierten den Wiederaufbau, so dass Häring und seine Architekturauffassung des organhaften Bauens keine wesentliche Rolle hierfür spielten und damit aus dem Blickfeld gerieten.
Im Beitrag von Sylvia Claus „What will happens when the Smithsons get their hand on Garkau?” wird die Wiederentdeckung des Hauptwerks von Hugo Häring, das Gut Garkau von 1922-1928, durch die New-Brutalism-Diskussion in Großbritannien der Fünfziger- und Sechzigerjahre thematisiert. War Häring ein Proto-Brutalist?
Als treibende Kraft hinter der Häring-Promotion fungierte der Stuttgarter Architekturhistoriker, Kritiker und Herausgeber Jürgen Joedicke. Seine Artikel über den legendären Vorzeige-Kuhstall der Moderne in den diskursbestimmenden Architekturzeitschriften Architectural Review und Bauen + Wohnen, beide von 1960, oder die Herausgabe des Reyner Banham-Klassikers Brutalismus in der Architektur (1966), trugen zur Bekanntheit des Gut Garkaus unter den Protagonisten des New Brutalism, vom Architektenpaar Alison und Peter Smithson bis Colin St. John Wilson, bei. Auf die anfängliche Bezugnahme eines Mies van der Rohes oder Le Corbusiers folgte beim New Brutalism die Rückbesinnung auf The Other Tradition Of Modern Architecture (Colin St. Wilson), u.a. eines Alvar Aaltos, um die Erschöpfung im Formalismus zu überwinden.
Der aktuelle Brutalismus-Hype zeigt sich in der Aufarbeitung an vielen Stellen unscharf. Vieles will heute – egal ob proto oder post – dem Brutalismus zugeschrieben werden, in der Kenntnis, dass sowohl die Protagonisten von damals ihre eigenen Schwierigkeiten mit einer Definition hatten. Gilt es Häring durch den Beitrag von Sylvia Claus für den Brutalismus-Hype anschlussfähig zu machen? Das Thema Häring und New Brutalism wird dankenswerterweise im Beitrag als historische Momentaufnahme dargelegt. Geradezu symptomatisch für die Person Häring mag dieser Umstand gewesen sein, dass sein kurzes Aufflammen in der damaligen Brutalismus-Diskussion endete, bevor es richtig Feuer fing. Banham führte dies auf Härings Merkmal als „one building man“ zurück. Dadurch blieb Häring der späte Ruhm posthum im Ausland verwehrt.
Sein Engagement im Kulturbereich nach seiner Rückkehr nach Oberschwaben blieb indessen bis heute unbemerkt. Judith Bihr folgt in ihrem Beitrag „Hugo Häring, die moderne Kunst und Biberach“ seinen Spuren als Vermittler, Kurator und Elder Statesman. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die „ausstellung moderner bildwerke“ im Biberacher Pestalozzihaus von 1952. Inwieweit Härings Kulturarbeit im Rahmen des „geistigen“ demokratischen Wiederaufbaus der jungen Bundesrepublik eine Rolle spielte ist ungewiss. Interessant erscheint, dass Häring sich in seinen Studien oder Vorträgen in der Nachkriegszeit u.a. mit der Ausgestaltung von Bildungslandschaften (Beispiel „werkraum oberschwaben“) auseinandersetze.
Mit der o.g. Ausstellung könnte dennoch ein Bildungsauftrag oder eine Aussöhnung verbunden werden, handelte es sich zum einen größtenteils um Bildwerke von Künstlern, die noch unter dem Nazi-Regime als „entartete Kunst“ verunglimpft wurden, zum anderen mag es Zufall sein, dass die Ausstellung an einem Ort, der nach dem Schweizer Pädagogen und Sozialreformer Johann Heinrich Pestalozzi benannt ist, Obdach fand.
Härings Kontakte aus der Berliner Zeit zu Künstlerkreisen des Expressionismus, der Abstraktion oder des Suprematismus kamen ihm bei der Kuratierung zugute. Der russische Künstler Kasimir Malewitsch überließ Häring einige Bilder nach der „Großen Berliner Kunstausstellung“ (1927) zur Aufbewahrung. Diese blieben nach dem Tod Malewitschs (1935) in Härings Besitz, überdauerten gut versteckt unter dem Bett die Kriegszeit und übersiedelten mit nach Biberach, wo sie schließlich 1952 der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Ein späterer Verkauf an die Stadt Biberach kam durch Missgeschicke nicht zustande, so dass Häring 1957 die Bilder an das Amsterdamer Stedlijk Museum übergab. Neben Malewitsch, Kirchner oder Matarée gesellte sich auch der oberschwäbische Maler Jakob Bräckle unter den auszustellenden Künstlern. Die Freundschaft mit Häring und die Auseinandersetzung mit der Avantgarde führten bei Bräckle zu einer neuen Schaffensphase der Abstraktion regionaler Prägung. Ein Synthesevermögen, welches auch Häring auf unprätentiöse Weise stets in seinem Werk zu vereinen wusste.
Der Werkkatalog in der Publikation zeichnet eine Gestaltfindung in der fast dreißigjährigen Praxis nach – von den eklektizistischen beziehungsweise historistischen Anfängen, geprägt durch den Lehrmeister Theodor Fischer, bis zur vollendeten Idee der „Leibesform“ des organhaften Bauens. Die auf warm-gelblichem Papier mit zartem Bleistift, kräftiger Kohle oder feiner Tusche festgehaltenen Raumideen kommen auf den hart-weißen Buchinnenseiten besonders gut zum Leuchten und werden großzügig platziert. Während die realisierten Projekte über Schwarzweißaufnahmen aus ihrer Entstehungszeit dokumentiert werden, zeigen nur ausgewählte Bauten durch aktuelle Farbaußenaufnahmen (2023) ihren heutigen Zustand. Die Entwürfe und Bauten werden in vier Kategorien sortiert: Städtebau, funktionelles Bauen, experimentelles Bauen und Bauen mit Licht. Die beiden Hauptprojekte in Härings Gesamtwerk, das Gut Garkau und die Wohnhäuser der Gebrüder Schmitz (gleichzeitig Schlusspunkt der baulichen Praxis), werden umfänglicher in der Publikation präsentiert. Auf eine Kontextbildung durch Abbildungen von Vergleichsprojekten anderer Architekten aus der jeweiligen Zeit wird durch die Herausgeber verzichtet – Häring steht für sich. Beim Betrachten des Gesamtwerks wird deutlich, dass es an gewisser Leichtigkeit, Zeichenhaftigkeit, Klarheit oder einem Hauch von Glamour mangelt. Es findet sich kein Entwurf im Oeuvre wie beispielsweise der kristalline Hochhausentwurf Friedrichstraße von Ludwig Mies van der Rohes oder keine strahlendweiße Wohnschlangen mit Dampfermotivapplikationen eines Hans Scharouns für die Siemensstadt. Vielleicht ist es gerade dieser Eigensinn Härings, der ihn im Vergleich zu seinen Zeitgenossen und ihren Meisterbauten wieder alltäglich erscheinen lassen – jenseits architektonischer Bildproduktion. Ebenso wird dem Leser das Nachvollziehen, woran man das organhafte Bauen in Material, Detail, Konstruktion, Raum erkennen kann, von Projekt zu Projekt nicht erleichtert. Der Theoretiker Häring wurde einem an dieser Stelle erspart! Auszüge seiner in Teilen schwer zugänglichen beziehungsweise verständlichen Texte sind nicht Bestandteil der Publikation.
Im Vorwort von Baubürgermeister Christian Kuhlmann oder im Beitrag zum Entwurfsstudio Garkau von Bernd Schmutz wird die Aktualität Härings hervorgehoben. Eine Transferleistung worin denn diese bestehen würde, bleibt unvermittelt oder der Interpretation des Lesers selbst überlassen. Dabei können für das heutige Baugeschehen und dessen Herausforderungen interessante Lösungsansätze für einfaches, ressourcenschonendes, serielles Bauen oder für bezahlbaren Wohnbau herausgefiltert werden. Härings Grundrißarbeiten zu diesen Themen bilden einen guten Fundus.
Nachvollziehbar wird der Gegenwartsbezug jedoch in der einen Frage, wie mit dem baulichen Erbe, insbesondere im ländlichen Raum, umzugehen ist. Gut Garkau fristet seit Jahrzehnten als leerstehende, denkmalgeschützte Landwirtschaftsanlage ein trübes Dasein – ein Zweckbau ohne Bauzweck. Anhand von ausgewählten studentischen Entwürfen werden Strategien für ein „Weiterbauen“ in der Publikation (Sonderbeitrag „Repairing Häring“) vorgestellt. Sie werfen dabei einen Fokus auf ein wichtiges Thema – der Bestandsentwicklung. Planen und Bauen im Bestand muss angesichts der Nachhaltigkeitsdiskussion immer mehr an Relevanz gewinnen.
Im Nachgang darf sich auch der im Buch viel zitierte Berliner Kunsthistoriker Adolf Behne (Der moderne Zweckbau, 1923) in seiner Argumentation, durch den heutigen Leerstand und langsamen Verfall des Gut Garkaus bestätigt fühlen, wenn er das einhergehende Unvermögen der Weiternutzung bei den „Leibesformen“ und den „individuellen Organismen“ des organhaften Bauens beim Verlust der „einen“ Funktion attestiert. Hat damit das organhafte Bauen im Verständnis Hugo Härings an Relevanz verloren, wenn zeitgemäßes Planen und Bauen nach mehr Flexibilität, Wandelbarkeit und Anpassungsfähigkeit verlangt?
Die Publikation stellt eine Handreichung dar, sich wieder mit dem besonderen baulichen Erbe von Hugo Häring, auseinanderzusetzen. Sie ist deshalb empfehlenswert, weil sie auch die wichtigen Zwischentöne der Architekturentwicklung des 20. Jahrhunderts wieder bespielt. Der Mensch Häring und sein Werk dürfen als eigenständige Position und als Alternative zu der „Heroenerzählung“ angesehen werden; genau, dass macht ihn besonders und interessant zugleich – auch heute noch.
Florian Dreher, Wiesbaden 2025